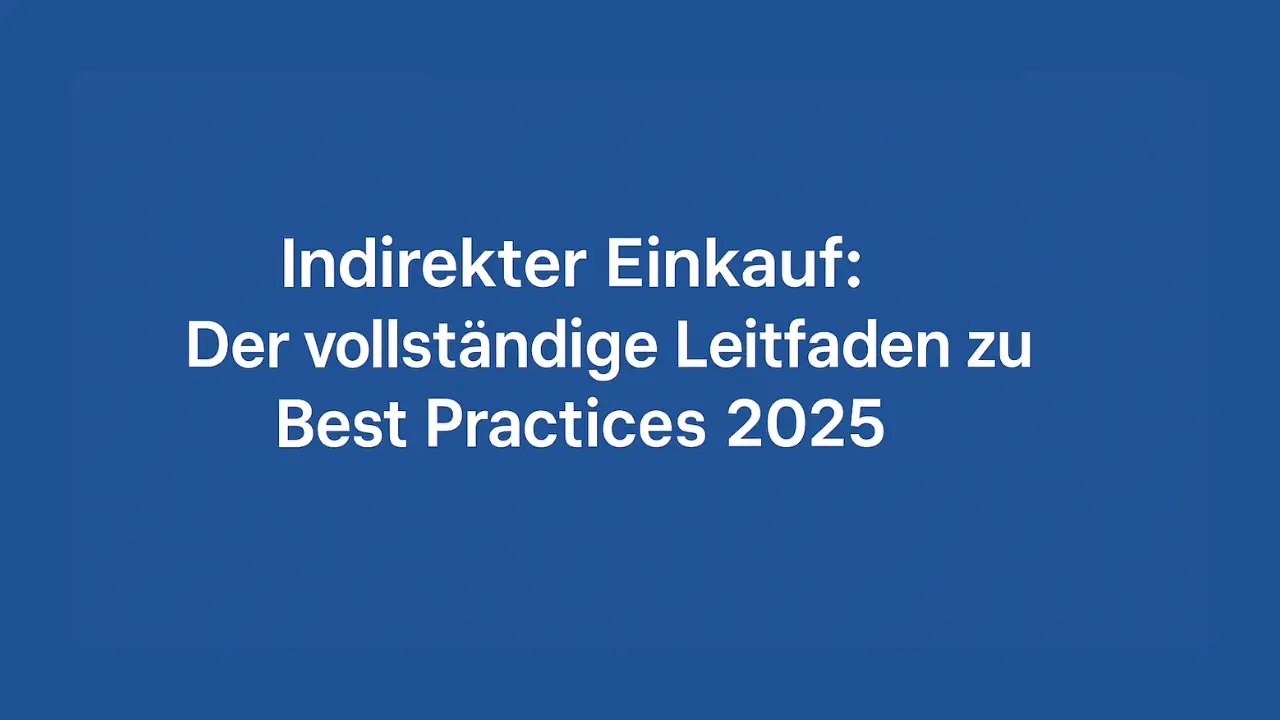Zusammenfassung
Dieser Leitfaden bietet einen umfassenden Überblick über den indirekten Einkauf – jene Beschaffungsprozesse, die den Unternehmensalltag unterstützen, ohne direkt ins Endprodukt einzufließen. Mit Einsparpotenzialen von bis zu 25% der Ausgaben ist der indirekte Einkauf ein strategischer Hebel für Unternehmen. Der Artikel beleuchtet Herausforderungen wie Maverick Buying und mangelnde Datentransparenz, stellt bewährte Strategien wie Kategoriemanagement vor und zeigt, wie Digitalisierung und KI den indirekten Einkauf revolutionieren.
Was ist indirekter Einkauf?
Frage: Was genau versteht man unter indirektem Einkauf?
Antwort: Indirekter Einkauf umfasst alle Waren und Dienstleistungen, die ein Unternehmen für seinen täglichen Betrieb benötigt, die aber nicht direkt in das Endprodukt einfließen. Denken Sie an IT-Equipment, Büromaterial oder Reinigungsdienstleistungen – alles, was den Geschäftsbetrieb am Laufen hält, ohne Teil des verkauften Produkts zu werden.
Frage: Worin unterscheidet sich indirekter vom direkten Einkauf?
Antwort: Der direkte Einkauf beschafft Materialien, die unmittelbar Teil des Endprodukts werden – wie Rohstoffe oder Bauteile. Der indirekte Einkauf hingegen kümmert sich um alles, was den Betrieb unterstützt. Ein einfaches Beispiel: In einer Autofabrik gehören Stahlbleche zum direkten Einkauf, während die Software für die Buchhaltung zum indirekten Einkauf zählt.
Frage: Welche typischen Kategorien umfasst der indirekte Einkauf?
Antwort: Der indirekte Einkauf deckt ein breites Spektrum ab: von IT-Ausstattung und Software über Büromaterial und Möbel bis hin zu Facility Management, Reinigungsdiensten, Marketing- und Beratungsleistungen sowie Reisekosten und Veranstaltungen. Laut Deloitte’s Third-Party Risk Management Survey umfasst der indirekte Einkauf durchschnittlich über 40 verschiedene Ausgabenkategorien, was seine besondere Komplexität erklärt.
Frage: Wie groß ist der Anteil des indirekten Einkaufs am Gesamteinkaufsvolumen?
Antwort: Typischerweise macht der indirekte Einkauf zwischen 15 und 30 Prozent des gesamten Einkaufsvolumens aus. Das klingt vielleicht nach wenig im Vergleich zum direkten Einkauf, aber stellen Sie sich vor: Bei einem mittelständischen Unternehmen können das schnell mehrere Millionen Euro sein!
Frage: Warum ist der indirekte Einkauf oft schwieriger zu steuern?
Antwort: Anders als beim direkten Einkauf wird der indirekte Einkauf häufig dezentral von verschiedenen Abteilungen durchgeführt. Hinzu kommt eine größere Anzahl an Lieferanten mit kleineren Bestellmengen. Diese Fragmentierung macht die zentrale Steuerung und Kontrolle zu einer echten Herausforderung.
Warum indirekter Einkauf für Unternehmen wichtig ist
Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum so viele Unternehmen den indirekten Einkauf neu strukturieren? Der Grund ist einfach: Hier schlummert enormes Potenzial! Laut McKinsey-Studien können Unternehmen durch systematische Steuerung bis zu 25% ihrer indirekten Ausgaben einsparen. Diese Einsparungen wirken sich direkt auf Ihr Betriebsergebnis aus.
Denken Sie an den indirekten Einkauf nicht nur als Kostenfaktor, sondern als strategischen Hebel. Wenn Sie Bedarfe bündeln, erzielen Sie bessere Konditionen bei Lieferanten und vermeiden doppelte Bestellungen. Das ist wie beim Großeinkauf im Supermarkt – je mehr Sie auf einmal kaufen, desto günstiger wird’s pro Stück.
Aber es geht nicht nur ums Geld. Standardisierte Abläufe im indirekten Einkauf machen Ihre Prozesse effizienter. Statt dass jede Abteilung ihre eigene Suppe kocht, folgen alle demselben Rezept. Das spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch den Verwaltungsaufwand erheblich.
Ein weiterer wichtiger Aspekt: Risikominderung. Ein strukturierter Beschaffungsprozess mit klaren Freigaben und sorgfältiger Lieferantenauswahl schützt Ihr Unternehmen vor bösen Überraschungen. Sie kennen das vielleicht – ein wichtiger Lieferant fällt aus, und plötzlich steht alles still. Mit einem gut organisierten indirekten Einkauf minimieren Sie solche Risiken durch bessere Überwachung und Alternativstrategien.
Die gute Nachricht: Die strategische Bedeutung des indirekten Einkaufs wird zunehmend erkannt. In vielen Unternehmen wird dieser Bereich inzwischen genauso professionell gesteuert wie der direkte Einkauf – und das aus gutem Grund, wie die Procurement Leaders Strategy Guide zeigt.
Häufige Herausforderungen im indirekten Einkauf
Im indirekten Einkauf gibt es typische Schwierigkeiten, die Abläufe verlangsamen und Einsparungen erschweren. Hier sind die drei größten Herausforderungen:
1. Maverick Buying begrenzen
Maverick Buying bedeutet, dass Mitarbeiter ohne Freigabe einkaufen – also außerhalb der festgelegten Einkaufsprozesse. Das passiert oft, wenn es keine klaren Regeln gibt oder wenn unter Zeitdruck gehandelt wird.
Dies führt zu höheren Kosten, geringerer Kontrolle über Ausgaben und fehlender Einhaltung interner Vorgaben. In deutschen Unternehmen machen solche Einkäufe etwa 20-30% aller Beschaffungsvorgänge aus.
Um Maverick Buying zu reduzieren, helfen:
- Klare Einkaufsrichtlinien
- Einfache, digitale Freigabeprozesse
- Schulungen für Mitarbeiter
2. Daten und Ausgabentransparenz schaffen
Im indirekten Einkauf sind Informationen über Ausgaben oft über viele Abteilungen verstreut. Diese Daten sind manchmal unvollständig oder nicht einheitlich erfasst.
Ein zentraler Überblick über die Ausgaben – durch Spend Analysis – erleichtert die Auswertung. Dazu werden alle Daten zusammengeführt, systematisch erfasst und mit digitalen Tools ausgewertet.
Spend Visibility: Die Transparenz über alle Ausgaben ist der erste Schritt, um den indirekten Einkauf zu optimieren. Nur was gemessen wird, kann auch verbessert werden.
3. Stakeholdermanagement verbessern
Indirekter Einkauf betrifft viele verschiedene Abteilungen mit eigenen Anforderungen. Diese Vielfalt macht die Abstimmung zwischen den Beteiligten anspruchsvoll.
Eine bessere Zusammenarbeit entsteht durch regelmäßige Kommunikation und klare Rollenverteilungen. Abteilungen, die von der Beschaffung betroffen sind, werden frühzeitig eingebunden, um Prozesse abzustimmen.
Strategien und Best Practices für mehr Effizienz
Mit klaren Methoden lässt sich der indirekte Einkauf effizient steuern. Die folgenden Best Practices bieten eine strukturierte Herangehensweise zur Prozessverbesserung.
1. Kategoriemanagement etablieren
Kategoriemanagement bedeutet, ähnliche Güter und Dienstleistungen in Gruppen zu bündeln. Diese Gruppen werden als Kategorien bezeichnet und einzeln analysiert.
Definition: Kategoriemanagement ist die Planung und Steuerung von Warengruppen mit dem Ziel, Kosten zu reduzieren und Qualität zu sichern.
Vorteile: Durch gebündelte Nachfrage entstehen bessere Verhandlungsmöglichkeiten, und das Wissen über einzelne Kategorien kann gezielter eingesetzt werden.
Der Prozess umfasst die Identifikation von Kategorien, die Analyse von Bedarfsmustern und die Entwicklung passender Beschaffungsstrategien. Typische Kategorien sind IT-Hardware, Facility Services oder Marketingdienstleistungen.
2. Lieferantenbasis konsolidieren
Eine große Anzahl an Lieferanten führt zu hohem Verwaltungsaufwand. Die Konsolidierung bedeutet, die Anzahl der Lieferanten zu reduzieren, ohne Risiken einzugehen.
Bei der Analyse der Lieferantenstruktur werden Doppelungen, geringe Ausgabenanteile und ungenutzte Verträge geprüft. Größere Einkaufsvolumen bei weniger Lieferanten führen zu besseren Konditionen und stabileren Beziehungen.
Wichtig ist dabei, alternative Anbieter zu berücksichtigen, um Abhängigkeiten zu vermeiden. Lieferanten werden regelmäßig nach Leistung, Preis und Zuverlässigkeit bewertet.
3. Richtlinien und Governance implementieren
Governance im Einkauf sorgt für einheitliche Abläufe und klare Zuständigkeiten. Dies umfasst Richtlinien, die alle Beteiligten verbindlich anwenden.
Einkaufsrichtlinien enthalten:
- Genehmigungsprozesse mit definierten Freigabestufen
- Wertgrenzen für Bestellungen
- Klare Rollenverteilungen und Verantwortlichkeiten
Automatisierte Systeme prüfen, ob alle Vorgaben eingehalten werden. Beteiligte werden regelmäßig über Änderungen informiert und in Schulungen eingebunden.
4. Kosten und Risiken mit Tools überwachen
Digitale Systeme unterstützen bei der Erfassung und Analyse von Kosten und Risiken. Diese Tools liefern strukturierte Daten für die Entscheidungsfindung.
Bei der Spend Analysis werden Ausgaben nach Kategorien, Abteilungen und Lieferanten analysiert. Die Datenbasis wird zentral zusammengeführt. Lieferantenrisiken, Vertragslaufzeiten und Abweichungen im Prozess werden bewertet.
Wichtige Kennzahlen (KPIs) sind Einsparpotenziale, die Häufigkeit nicht genehmigter Bestellungen und Bearbeitungszeiten. Die Ergebnisse werden regelmäßig überprüft und Maßnahmen angepasst.
Digitalisierung und Automatisierung im indirekten Einkauf
Die Digitalisierung verändert den indirekten Einkauf grundlegend. Sie macht Abläufe schneller, transparenter und nachvollziehbarer. Softwarelösungen übernehmen Routineaufgaben und ermöglichen den Zugriff auf Daten in Echtzeit.
1. E-Procurement-Plattformen einführen
E-Procurement-Systeme bilden den gesamten Beschaffungsprozess digital ab. Sie umfassen Funktionen wie Katalogmanagement, elektronische Genehmigungen und Berichte zur Auswertung.
Die Einführung erfolgt in mehreren Schritten. Nutzer werden in den Prozess einbezogen und geschult. Alle Daten werden systematisch erfasst, und die Abläufe werden schneller und nachvollziehbar.
Ein großer Vorteil ist der Self-Service: Mitarbeiter können ihre Bedarfe selbst erfassen, verfolgen und verwalten, ohne den Einkauf bei jeder Anfrage einzubeziehen.
2. KI-gestützte Analysen nutzen
Künstliche Intelligenz (KI) unterstützt bei der Auswertung großer Datenmengen im indirekten Einkauf. KI kann Beschaffungsdaten automatisch analysieren und nach Warengruppen zuordnen.
Mithilfe von Predictive Analytics lassen sich zukünftige Bedarfe modellieren. Aufgaben wie das Prüfen von Rechnungen oder das Erkennen von Anomalien erfolgen automatisiert.
Die Analyse liefert Informationen, die in die Planung und Steuerung des Einkaufsprozesses einfließen. So wird der strategische Einkauf durch Technologie unterstützt.
3. Prozessabläufe standardisieren
Einheitliche Prozesse sorgen für Klarheit im indirekten Einkauf. Standardisierung reduziert Fehler und vereinfacht die spätere Automatisierung.
Zu den Prozessen, die standardisiert werden, gehören:
- Das Anlegen von Bedarfen
- Genehmigungsprozesse
- Die Aufnahme neuer Lieferanten
Mitarbeiter werden frühzeitig einbezogen und erhalten gezielte Schulungen. Die Wirksamkeit lässt sich anhand von Kennzahlen wie Bearbeitungszeit, Fehlerquote oder Nutzerzufriedenheit bewerten.
Zukunft des indirekten Einkaufs
Der indirekte Einkauf wird in den nächsten Jahren stärker von technologischen und gesellschaftlichen Veränderungen beeinflusst. Unternehmen berücksichtigen vermehrt ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) bei der Auswahl von Lieferanten und Produkten.
Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen werden genutzt, um Daten zu analysieren, Muster zu erkennen und Prozesse automatisch auszuführen. Durch diese Technologien lassen sich Bedarfe vorhersagen oder Lieferantenrisiken frühzeitig erkennen.
Viele Organisationen setzen auf integrierte Source-to-Pay-Lösungen. Diese Systeme verbinden alle Schritte vom Bedarf über die Bestellung bis zur Bezahlung in einer Plattform. So entsteht ein durchgängiger, digital gesteuerter Prozess.
Die Rolle der Einkaufsfachkräfte verändert sich ebenfalls. Neben klassischem Verhandlungsgeschick sind Kompetenzen im Umgang mit Daten, digitalen Tools und analytischem Denken gefragt. Der indirekte Einkauf entwickelt sich zu einem datenbasierten Funktionsbereich.
Den indirekten Einkauf optimieren – nächste Schritte
Indirekter Einkauf umfasst viele unterschiedliche Ausgabenkategorien und Prozesse. Der erste Schritt zur Verbesserung ist eine strukturierte Spend Analysis. Dabei werden alle indirekten Ausgaben gesammelt, klassifiziert und analysiert.
Nach der Analyse folgt die Definition klarer Warengruppen und Richtlinien. Kategorien wie IT, Facility Management oder Marketing werden dabei einzeln betrachtet. Für jede Kategorie lassen sich spezifische Strategien entwickeln.
Digitale E-Procurement-Systeme ermöglichen die Abbildung dieser Prozesse in einer einheitlichen Plattform. Dazu gehören Funktionen wie elektronische Freigaben, Katalogbeschaffung und Reporting. KI-basierte Werkzeuge unterstützen bei der Kategorisierung von Ausgaben.
Zycus bietet eine Source-to-Pay Suite mit KI-gestützten Modulen an. Diese umfasst automatisierte Rechnungsprüfung, digitale Bedarfsanforderungen und Lieferantenmanagement. Die Plattform ist für Unternehmen mit dezentralen Strukturen und komplexen Einkaufsanforderungen konzipiert.
FAQs
Q1. Welche Waren und Dienstleistungen gehören zum indirekten Einkauf?
Indirekter Einkauf umfasst Güter und Dienstleistungen, die für den täglichen Betrieb eines Unternehmens benötigt werden, aber nicht ins Endprodukt einfließen. Dazu zählen IT-Ausstattung, Büromaterial, Beratungsleistungen, Facility Management, Geschäftsreisen und Marketingaktivitäten.
Q2. Wie misst man den Erfolg von Optimierungen im indirekten Einkauf?
Der Erfolg wird durch verschiedene Kennzahlen gemessen: Kosteneinsparungen, verbesserte Prozessgeschwindigkeit, Einhaltung von Richtlinien und Verringerung nicht genehmigter Einkäufe (Maverick Buying). Digitale Systeme erfassen diese Daten automatisch.
Q3. Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit im indirekten Einkauf?
Nachhaltigkeit im indirekten Einkauf bezieht sich auf die Auswahl von Lieferanten, die Umweltstandards einhalten, Ressourcen schonen und soziale Vorgaben berücksichtigen. Unternehmen integrieren zunehmend ESG-Kriterien in ihre Lieferantenauswahl und Einkaufsprozesse.
Q4. Wie beginnt man mit der Optimierung des indirekten Einkaufs?
Die Optimierung beginnt mit einer Analyse der bestehenden Ausgaben (Spend Analysis). Danach erfolgt eine strukturierte Kategorisierung der Einkaufsbereiche. Auf dieser Grundlage lassen sich Richtlinien festlegen und digitale Lösungen einführen, um Abläufe zu standardisieren.
Verwandte Lektüren: